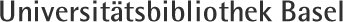GG 474
Oratio de ortu, vita, et obitu Ioannis Oporini Basiliensis, Typographicorum Germaniae Principis, recitata in Argentinensi Academia ab Ioanne Henrico Hainzelio Augustano. Authore Andrea Iocisco Silesio, Ethicorum in eadem Academia professore. Adiunximus librorum per Ioannem Oporinum excusorum Catalogum... Strassburg: Theodosius Rihel 1569. 8°.
Im Jahr nach dem Tod und dem Basler Erinnerungs-Einblattdruck (GG 473) erscheint eine weitere Erinnerungsschrift an Oporin, diese sogar in Strassburg. Dieser Druck besteht zur Hauptsache aus eben dieser Schrift über Geburt, Leben und Tod "des bedeutendsten Druckers Deutschlands", aus der wir, aus der Erinnerung des Druckers, auch einiges Interessante über seinen Vater, den Maler Hans Herbst(er), und über seinen Herrn während zweier Jahre, den berühmten Arzt Theophrastus Paracelsus erfahren, aus der Feder des damaligen Strassburger Professors für Ethik Andreas Jociscus, und einem alphabetischen Katalog der Drucke Oporins (allerdings nicht vollständig). Zwischen diesen beiden eine kleinere Schrift über Vorzeichen des Todes Oporins, bemerkt und aufgezeichnet vom italienischen Emigranten und Basler Professor für Rhetorik Celio Secondo Curione (gest. November 1568), auf den letzten Seiten eine lateinische Grabinschrift sowie griechische und lateinische Grab- und Trauerepigramme einer Reihe von Autoren und Editoren seiner Offizin: neben dem Kunst- und Münzensammler Louis Demoulin de Rochefort u.a. von Johannes Sambucus, Hieronymus Wolf, Wilhelm Xylander, Pierre Pithou, Karel Utenhove, Martin Crusius, Georg Fabricius.
Der aus Grünberg in Schlesien stammende Johannes Jociscus hatte sich 1562 in Wittenberg, 1566 in Heidelberg und 1567/68 in Basel an der Universität immatrikuliert und war anschliessend an diese Studien in Strassburg zum Professor für Ethik am berühmten neuen dortigen Gymnasium (Academia) gewählt worden. Jociscus selber ist noch im Jahre dieser Gedenkrede, vor dem 2. Dezember 1569 gestorben, wie wir einem Hinweis Johann Ludwig Havenreuters entnehmen können (s. Nr. 231). Gewidmet hat Jociscus seine Rede dem berühmtesten Arzt Schlesiens in seiner Zeit, Johannes Crato von Crafftheym. Vorgetragen hat sie der junge Augsburger Patrizier Johann Heinrich Hainzel, zu dieser Zeit Student am Strassburger Gymnasium. 1545-1549 hatte Crato seine jungen Freunde Johann Baptist und Paul Hainzel zu ihren Studien nach Italien begleitet, seit 1564 war er Leibarzt Kaiser Maximilians II. (zuvor seines Vaters Ferdinand), 1567 von ihm geadelt worden.
In einer kurzen Rede habe er kürzlich in der Akademie den Manen Oporins geopfert, beginnt Jociscus seine Widmung von Strassburg, 12. März 1569. Das hätten seine Verdienste um die Gelehrtenwelt (in Rempubl. litterariam) verlangt. Er habe die Rede nicht veröffentlichen wollen, doch auf Bitten hin eingewilligt. Im Monat des Ausbruchs seiner Krankheit habe Oporin ihn, da er sich auf dem Weg nach Strassburg befunden habe, gebeten, eine Geldangelegenheit bei einem Freund bekannten Namens (dessen Hilfe er schon öfters erfahren habe) zu erledigen. Da habe er die Gelegenheit ergriffen und ihm, von seinen Plackereien ausgehend, seinen Lebenslauf, vom Beginn seiner Druckertätigkeit (auch noch Früheres: s. unten) bis zu jenem Tag, erzählt. Viel von diesem Gespräch habe sich mit jenen Verwirrungen (wohl die Ereignisse um Paracelsus: s. unten) befasst, das er weggelassen habe, ebenso was andere hätte verletzen können. Was sich um des Zusammenhangs der Erzählung willen über Theophrast (d.i. Paracelsus) hier finde, hätten neben ihm schon viele gewichtige Gelehrte von Oporin selber gehört. So sage er hier nichts aus Schmähsucht. Immer habe er die Gemeinheit derer verabscheut, die Lebende mit bissigem Hohn zerfleischten oder Tote gegen das heilige attische Gesetz beschimpften. In seinem Namen solle diese kleine Schrift erscheinen, da er wisse, wie hoch er Oporin geschätzt habe (1555 war bei Oporin sein - neben einer deutschen Pestschrift im Auftrag des Breslauer Rates - erstes Werk erschienen, seine Methodus therapeutikē ex sententia Galeni & I.B. Montani). Und wenn Mediziner einer andern Richtung (secta) ihn angreifen sollten, wisse er sich in seinem sichern Schutz.
Als Beispiel der Tugend und des Fleisses für die Jugend, beginnt Jokisch seine Trauerrede, stelle er knapp das Leben Oporins, des Chorführers unter den Druckern, dar, ein Beispiel der Zerbrechlichkeit des Menschen und der Unbeständigkeit. Er beginnt mit seiner Geburt an Pauli Bekehrung (25. Januar) 1507 und seiner Kindheit in der gelehrten Stadt Basel, die aus den Ruinen von Augusta Rauracorum entstanden sei, ihren Namen von Caesars Legaten Basilius Minutius haben solle (wohl eine Kompilation aus dem Namen des Gründers Augsts Munatius Plancus und dem Namen Basels und der legendären Erfindung eines Römers Basilius), laut Erforschern alter Quellen vom freien Ãœbergang (Beatus Rhenanus hat 1531 den Namen von einem gallischen Wort passus = trajectus abgeleitet), seinem Vater, dem bedeutenden Maler, rechtschaffenen und frommen Johannes Herbst, dass er seinen Namen nach Versen Martials in opōrinos gräzisiert habe, vorausahnend, dass er einst mit Robertus Winterus zusammenarbeiten werde, der sich dann cheimerinos nenne. Sein Grossvater habe in Strassburg das Bauamt geleitet, habe seinen einzigen Sohn die Freien Künste studieren lassen wollen, doch der Hass der Stiefmutter habe das verhindert. Er sei dem Stadtschreiber anvertraut worden, um in dessen Haus die Schönschreibekunst zu erlernen. Da er aber der eleganten Schriftmalerei geneigter geschienen habe, sei er vom Sohn seines Herrn, der Maler gewesen sei, hierzu hinübergezogen worden. Als er darauf einst dem Vater ein Muster seiner Schreibkunst habe zeigen sollen, habe er gestanden, worum er sich bemühe. Unbarmherzig sei ihm von seinem Vater das Haus verboten worden. Aus der Heimat vertrieben und der Hoffnung, Liebe und Erbe des Vaters wiederzugewinnen, beraubt, habe er sich ganz der Malerei hingegeben und sei in seiner Generation nicht einer der schlechtesten Künstler geworden. Eine gute Anlage gedeihe überall. Das beweise deutlich Oporins Vater, der seine natürliche Begabung fleissig ausgebildet habe und sich seiner Vaterstadt würdig erwiesen habe. Während der Ausübung seiner Kunst in Helvetien (Zürich? nach Zwinger war er diese Zeit in Deutschland tätig; Basel gehörte in den 1580er Jahren immerhin noch nicht zu Helvetien = Eidgenossenschaft) habe er den Vater verloren. Man habe den Sohn, den einzigen Erben, suchen lassen. Man sei in Helvetien zu ihm gelangt, doch habe sein Meister, aus Furcht, den grossen Verdienst aus seiner Tätigkeit zu verlieren, ihn verleugnet. Durch diese Niederträchtigkeit seines Meisters um die ansehnliche Erbschaft gebracht, habe er sich nach Basel begeben (Zunft zum Himmel Mai 1492). Dort habe er durch seinen Fleiss hohes Ansehen erworben, habe Barbara Lupfartin (Lupfridin) geheiratet und von ihr drei Töchter (deren eine der Gelehrtenwelt den berühmten Philosophen und Arzt Theodor Zwinger geschenkt habe) und diesen Sohn Johannes gehabt. Sie habe ihm nichts als ihre Tugend, er ihr nichts als seinen Fleiss gebracht gehabt. Dadurch hätten sie trotz ihrer Arbeit jeweils kaum ihren Lebensunterhalt verdient. Da sie das Gedeihen ihrer Kinder daher eher in deren eigenem Fleiss als in einer reichen Erbschaft gesehen hätten, habe der Vater seinen Sohn gewissenhaft in den Anfängen der Sprache unterrichtet, in die öffentliche Schule geschickt und den Lernstoff mit ihm wiederholt, und die Mutter habe den Töchtern jede würdige Frauenarbeit beigebracht. Der Unterricht der Jugend habe damals begonnen, besser zu werden, weil Sprachen und Literatur durch die Bemühungen der Gelehrten ihren Glanz zurückerhalten hätten und die Werke der guten Autoren (d.h. der antiken Klassiker), wiederhergestellt, wieder verfügbar geworden seien. Da die Anlagen des jungen Oporin viel versprochen hätten, habe der Vater alles getan, sie zu fördern.
Nach diesem glücklichen Anfangsunterricht zu Hause sei er wegen der Armut des Vater hierher nach Strassburg gekommen und habe etwa vier Jahre im Haus der armen Schüler gewohnt. Unter Gebwiler (Hieronymus Gebwiler) habe er rein und flüssig lateinisch sprechen und bewundernswert griechisch gelernt. Dann sei er in seine Heimat zurückgekehrt, um seine Bildung zu vervollständigen. Bei gelehrten Männern (an denen Basel immer reich gewesen sei) habe er fleissig die Freien Künste gelernt (d.h. er hat sich 1533 an der Universität immatrikuliert). Doch da der Vater ihm in seiner Armut keine Unterstützung habe gewähren können, habe er sich zum Abt von St. Urban im Luzernbiet begeben und dort die angehenden Kollegiumsschüler unterrichtet. Dort habe er sich mit dem gebildeten Luzerner Chorherrn Xylotectus angefreundet. Dieser habe dann bald das reine Evangelium angenommen (d.h. er ist zur Reformation übergegangen), seine Pfründen verlassen, geheiratet, sich nach Basel begeben und sei hier an der Pest gestorben (19.8.1526). Auch Oporin habe die Klosterschule verdrossen; er sei dem Freund nach Basel gefolgt, um die Studien abzuschliessen. Doch auch da ohne Unterstützung, habe er die Abschrift griechischer Theologen, z.B. des Irenaeus, übernommen, die Johannes Froben mit grossem finanziellem Aufwand herausgegeben habe. Immer noch habe ihn Armut bedrängt. Schliesslich habe er, als Dienst am verstorbenen Freund, 1527 zu seinem grossen Unglück die verbitterte alte Witwe des Xylotectus geheiratet. Da habe er wie Sokrates mit einer Xantippe philosophieren gelernt und habe es geduldig ertragen. Er habe damals mit Erfolg die heimische Literarschule geleitet. Und noch heute erzählten nicht wenige, dass sie die Anfangskenntnisse und eine hierauf gebaute solide Bildung von Oporin erhalten hätten. Doch er habe sich um weitere Studien bemüht, um der ständigen Plackerei zu entgehen. Da habe Johannes Oecolampad, der erste Bekenner des reinen Evangeliums in Basel, ihn in Erkenntnis seiner allseitigen, aber nicht zum Kampf geeigneten Begabung zum Studium der Medizin veranlasst, zumal Theophrastus Paracelsus damals in Basel gewesen sei, der verkündet habe, in einem Jahr hervorragende Lehrer dieser Kunst heranzubilden (dies auf einem Flugblatt; zudem hat er zahlreiche Schüler schon nach Basel mitgebracht). Theophrast (wie er in der Folge allein genannt wird) sei bei Beginn der Reformation nach Basel gekommen und im Namen des Glaubens von Oecolampad empfangen und den Behören empfohlen worden. Die Akademie (Universität) sei damals verstreut gewesen, ein Teil der Professoren verjagt (die Altgläubigen), ein Teil von sich aus ausgezogen (1529 wurde sie vollständig geschlossen, bis 1532). So habe er mit Hilfe Oecolampads leicht die Professur für Medizin erhalten. Nach dem Rat Oecolampads habe sich Oporin Theophrast angeschlossen und habe ihm während seiner ganzen Basler Zeit als Famulus und Amanuensis gedient, in der Hoffnung, so die verkündete vollendete Kenntnis der Kunst zu erlangen. Daher habe Oporin zuerst mit grosser Bewunderung die Vorlesungen Theophrasts, der eine grosse Schar von Anhängern, schon berühmte Philosophen und Mediziner, gehabt habe, besucht und die Erklärungen (denn er habe gegen den Brauch in der Volkssprache gelehrt) getreu lateinisch festgehalten. Theophrast habe, wie Oporin oft beteuert habe, nur geringe Lateinkenntnisse besessen, doch ein so gutes Gedächtnis, dass er ganze Stellen aus Galen auswendig vorgetragen habe. Was Oporin aus der Muttersprache übersetzt habe, auch was er beim Diktat nicht verstanden oder in einer Vorlesung verworren aufgeschrieben habe, habe Theophrast alles richtig gefunden. Das habe Oporin oft veranlasst, in so rascher Zustimmung einen Betrug zu vermuten. Bei Exkursionen mit seinen Schülern zum Sammeln von Kräutern habe er, wenn er den Namen einer Pflanze nicht gekannt habe, jeweils erklärt, die werde nicht angewendet. Im Eifer, bei solchen Unannehmlichkeiten wenigstens entsprechende Fortschritte im Medizinstudium zu erzielen, habe er auch das wahnsinnige Verhalten, wenn jener betrunken gewesen sei, mit grösster Geduld ertragen, nicht anders als Hippokrates, der um medizinischer Erkenntnisse willen nicht gezögert habe, sogar von Exkrementen zu kosten, oder Kleanthes, der, um trotz seiner Armut tagsüber philosophieren zu können, nachts für einen Gärtner um Lohn Wasser geschöpft habe. Nach einer Anekdote über die Temperamentsbestimmung durch den Urin kommt Jociscus auf die Erzählung vom nächtlichen Kampf des betrunkenen Paracelsus mit gezücktem Schwert gegen Gespenster, zu sprechen, der jeweils nicht ohne Angst und Gefahr für Oporin gewesen sei, der im selben Raum geschlafen habe, worauf er Oporin jeweils zur Aufnahme von Diktaten habe aufstehen heissen, die so geschwind dahergesagt worden seien, dass er sie von Dämonen eingegeben vermutet habe. Und zweifellos sei das meiste, was gedruckt worden sei, von Oporins Hand niedergeschrieben worden, und da er umgänglich gewesen sei, habe er es den Leuten seiner Schule ohne weiteres mitgeteilt (es sind daneben auch Vorlesungsnachschriften Basilius Amerbachs später gedruckt worden). Oft sei er zu den von Paracelsus übermässig geliebten Gelagen beigezogen worden, sei jedoch nicht ständig dabei gewesen, da sein Geist, eher zur Pflege der Wissenschaften geeignet als zu Gelagen, häufige Räusche nicht vertragen habe. Die Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit Oporins rühme Theophrast sehr und in einem seiner Büchlein bekenne er, dass Oporin sein einziger zuverlässiger Famulus gewesen sei (in Von der französischen Krankheit drei Bücher Para von 1529: er habe "auch in sonderheit in allem vertrauen gepraucht meinen getreuen Johannem Opporinum"; hier verwahrt er sich auch dagegen, dass Griechischkenntnisse auch schon medizinsche Kenntnisse seien: "Es ist die grösst verfürung der arznei, (die) bei meinen zeiten umlauft, das vil, die nichts anderst wissen als ein wenig der sprach graecorum, wie sie die gelernt haben, do sie schuolmeister warent, do sie correctores und do sie bei Erasmo warent, nun so etlich bücher der arznei aufm grekischen angefangen haben, vermeinen sie, dieweil die sprach die bücher regir, so regir sie auch die kranken": nach Steinmann S. 6/7).
Auf diese Weise habe Theophrast fast zwei Jahre in Basel gelebt (Herbst 1526 - Februar 1528). Wegen seiner grossen Erfolge in der Behandlung hoffnungsloser Krankheiten sei er hoch bewundert worden. Hier schliesst die Geschichte der Heilung des adligen Domherrn Cornelius von Lichtenfels von einem langwierigen Magenübel an, die zu seiner Flucht aus Basel geführt hat. Dieser habe ihm für eine Heilung von sich aus hundert Gulden zu zahlen versprochen und abgemacht gehabt; Paracelsus habe ihn mittels dreier mit Speichel durchgearbeiteter Pillen seines Laudanum (eines Heilmittels, das er nur in äussersten Notfällen angewandt habe) geheilt. Der so rasch und scheinbar durch eine Kleinigkeit geheilte Domherr habe den Vertrag gebrochen - er hätte wahrhaft längere Qualen und Schmerzen verdient. Theophrast sei vor Gericht gegangen. Als dort für die übliche und von der Behörde festgesetzte Bezahlung (sechs Gulden) entschieden worden sei, habe Theophrast sich über einen so schäbigen Preis für seine Kunst empört und den Richter ungestüm angegriffen, so dass man eine Bestrafung für Behördenbeleidigung gefürchtet habe. Er sei deshalb auf Empfehlung einflussreicher Männer, die sich für seine Ehre eingesetzt hätten - und auch Oporin habe nicht aufgehört, ihn zum Wegzug zu drängen -, ins Elsass gezogen und habe Oporin seine chymischen Gefässe hinterlassen (Paracelsus hatte 1526/27 Johannes Froben von einem Fussleiden geheilt, dann auch Erasmus behandelt, war im Frühjahr 1527 als Stadtarzt angestellt worden; der Wegzug fand im Februar 1528 statt: am 28. Februar und nochmals - Antwort auf einen nur im Konzept erhaltenen Brief Amerbachs - am 4. März hat Paracelsus aus Colmar an Bonifacius Amerbach geschrieben). Theophrast habe Oporin versprochen gehabt, ihm das Rezept des Laudanum zu vermachen. In dieser Hoffnung habe er ihn ins Elsass begleitet wie er dafür schon die zwei Jahre zuvor sein schroffes Wesen ertragen habe. Als er die Hoffnung aufgegeben habe, habe er ihn verlassen. Auch habe die Gottlosigkeit Theophrasts diese Trennung beschleunigt: Als er von einem kranken Bauern gerufen worden sei und erfahren habe, dass dieser das Abendmahl empfangen habe, habe er erklärt, dass seine Kunst nicht für jemand da sei, der auch einen andern Helfer suche: entweder Blasphemie oder ein unkluger Versuch, seine Kunst vor einem Misserfolg zu bewahren. Es gebe jedenfalls Schriften Theophrasts, in denen er die Magie anerkenne und dass ein frommer Mensch die Dämonen, wie den Einsatz eines Banditen, zu Hilfe nehmen dürfe. Der noch lebende Wolfgang Wyssenburg (damals seit 1518 Pfarrer am Spital, Mitarbeiter Oecolampads bei der Basler Reformation, Professor für Neues Testament 1541-1554) habe ihm widersprochen, als er in einer öffentlichen Vorlesung erklärt habe, dass, wenn Gottes Hilfe nicht ausreiche, man die des Teufels beiziehen solle; doch er habe, mit Schmähungen überhäuft, der Wut des Kerls weichen müssen. Oporin sei unter die Herrschaft seiner Frau zurückgekehrt, nachdem er von ihm einen Teil Laudanum erhalten habe, das ihn bald darauf gerettet habe: Bei einer schweren Erkältung habe er einst, als er allein gewesen sei, sich des Laudanums erinnert, sei, allein im Hause, zu dem Beutel gekrochen, in dem es sich befunden habe, habe drei Pillen verschlungen und sei eingeschlafen. Als seine Frau, in der Erwartung ihn tot anzutreffen, aus der Predigt gekommen sei, sei er gesund gewesen. In diesem Heilmittel erweise sich die Bedeutung des Geistes Theophrasts. Wenn er neben dieser Begabung Frömmigkeit und eine feinere Bildung gezeigt hätte, wäre er der beste Arzt nach Asklepios gewesen. Wenig später sei nach acht Jahren der Ehe seine Frau gestorben. Aus der erwarteten Erbschaft sei durch Zutun der Verwandten nichts geworden.
In Basel habe Griechisch damals der grosse, aus Heidelberg herberufene Grynaeus gelehrt. Er habe Oporin wegen der Feinheit seines Geistes und seiner Sitten und hervorragender Griechischkenntnisse sehr geschätzt und umgekehrt dieser den Lehrer Grynaeus hoch geachtet. Es sei edlen Männern eigen, vom Unglück derer betroffen zu sein, die, böte sich eine Gelegenheit, dem Staat zur Zierde gereichten, besonders indem sie in Erinnerung an ein eigenes ehemaliges herbes Schicksal nach Kräften anderer Unglück zu lindern trachteten. So habe Grynaeus Oporins Sache gefördert, seine Studien und seine Begabungen andern empfohlen. Als ihm vom Rat die Lehre der heiligen Schrift übertragen worden sei, habe er bewirkt, dass Oporin seine frühere Stelle erhalten habe (im Jahre 1538: entgegen neuerer Datierung war Grynaeus nach Eintrag in der Matrikel der Artistenfakultät noch 1537, nach einer Notiz Johannes Zwingers - 1634-1696 - sogar noch 1538 Decanus artium; Oporin, 1526 Lehrer an der Leonhardschule, 1529 Schulmeister an der Lateinschule auf Burg, seit 1533 Dozent der lateinischen Sprache, wird 1538 Professor für Griechisch). Er habe in ihr ruhmreich und mit grossem Erfolg gewirkt, habe eine wunderbare Klarheit, Geschicklichkeit und gebildete Leichtigkeit des Unterrichts besessen. Er habe die griechischen Viten Plutarchs vor zahlreichen Zuhörern erklärt, zu denen auch sein Vater gehört habe, der damals mit dem berühmten Lazarus von Schwendi und dem vornehmen Augsburger Georg von Stetten studienhalber in Basel geweilt habe (der später berühmte Kriegs- und Staatsmann von Schwendi hatte sich 1536/37, Stetten 1534 in Basel immatrikuliert, der Vater des Jociscus findet sich nicht in der Basler Matrikel). Oporin habe jeweils diese und weitere Schüler zu sich nach Hause mitgenommen und aus seiner Neigung zu seinen Hörern heraus die Vorlesungen mit ihnen repetiert. Diese Leistungen hätten seine Schüler ihm nicht vergessen und ihren Dank ihm gebührend abgestattet. Schwendi selber habe ihm mehrmals in seinen Schwierigkeiten geholfen, nicht weniger grosszügig sei Stetten gewesen, seinen Vater wolle er nicht rühmen, sich aber seinen eigenen Lehrern gegenüber ebenso verhalten.
Diesen Ausführungen lässt Jociscus die Begrüssung des Erasmus in Basel im Jahre 1535, an der Oporin als Vorsteher des Collegiums von amtswegen teilgenommen und eine würdige Ansprache gehalten habe, anekdotisch ausgemalt folgen. In dieser Stellung habe er mit seiner Gattin und drei Stiefsöhnen, deren aller Aufwand seinen Verdienst überstiegen habe, gelebt und die Universität zu verlassen geplant, besonders nach einem Streit des Grynaeus mit Carlstadt über die Stufen an ihr (als in den 1530er Jahren die reformierten Theologen auf Doktorpromotion und -titel hatten verzichten wollen, hatten Stadt und Universität den dissidenten Lutheraner Andreas Carlstadt aus Zürich berufen und ihn zu einer Disputation über die Bedeutung von Magisterium und Doktorat verpflichtet. Alle Professoren wurden vor die Wahl gestellt, zu promovieren oder die Vorlesungen einzustellen. Wyssenburg promovierte bei Carlstadt, Grynaeus wurde gezwungen, seine Vorlesungen mit Carlstadt zu teilen, Sebastian Münster gab seine neue Theologieprofessur 1542 wieder auf. Oporin scheint für Steinmann der Anführer der Promotionsgegner an der Artistenfakultät gewesen zu sein und überlegte sich in seiner unsicheren Lage nach der Einführung der neuen Universitätsstatuten am 26. Juli 1539 - ausserdem verlangte man von ihm, seine Tätigkeit in den Druckereien einzustellen - auch den Wegzug von Basel.). Er habe mit seinem Schwager Robert Winter zu drucken begonnen und sich ganz dem gewidmet. Er hätte auch damals noch in seiner Stellung steigen können, wenn ihn das Schicksal nicht ganz in den Schwierigkeiten des Buchdrucks hätte versinken lassen wollen. Denn die Vorsteher der Universität hätten, in Kenntnis der frühen Zeugnisse seiner Bildung und in Erwartung eines eindeutigen Vorteils für das Staatswesen, ihm die reichlichen Einkünfte des Petersstifts (das die Basler Behörden für die sog. Professoren der Fakultäten bestimmt hätten) für ein Rechtsstudium zugesprochen. Er habe Bonifacius Amerbach gehört und dessen Unterricht umso mehr geschätzt, als er - für ihn eine Erinnerung an sein Jugendstudium - die Gesetzestexte mit Zitaten aus den Philosophen, namentlich Plato und Aristoteles, begossen habe. Amerbach habe die Rechts- und Philosophiestudien so kunstgerecht verknüpft, dass er sowohl unter den Juristen wie unter den Philosophen den Siegespreis verdient habe. Doch den Disputationen, wie sie Amerbachs Unterricht mit sich gebracht habe, abgeneigt und ein Leben fern den Streitigkeiten vorziehend, habe er auch diese Gelegenheit fahren lassen und habe die Möglichkeit, sich diesen Mühen zu entziehen, gern ergriffen. Wenn allerdings der Universitätsvorstand die versprochenen Einkünfte, worum er gebeten, bestätigt und seine Schulden durch die Übernahme von mit Winter zusammen gedruckten Büchern getilgt hätte, hätte er gern ihren Entscheid befolgt. Doch die Behörden hätten, verärgert über seinen Ruf der Unzuverlässigkeit, ihn seinem Schicksal überlassen.
Dass es einem Menschen nicht freistehe, seinen Weg zu gehen, könne das Beispiel Oporins zeigen. Wie Hercules am Scheideweg bei Prodicus sei Oporin unentschieden gewesen. Aber er habe sich weder der Medizin, der er nicht ferngestanden, noch der Jurisprudenz, zu der ihn deren Ehren und Einnahmen hätten verlocken müssen, zugewandt, sondern dem Leben eines Buchdruckers, an das er zuvor nie gedacht habe: ein Beweis, dass Gott unsere Handlungen weise lenke, zur Verbreitung seines Wortes, zu seinem Ruhm und unserem Heil. Denn wie die Druckkunst Oporin rücksichtslos von den Studien weggeholt habe, indem sie den Weg zu einem beständigeren und dauerhafteren Wohlergehen, das jene gebracht hätten, verschlossen habe, so habe sie der Gelehrtenrepublik einen gewaltigen Vorteil gebracht und er habe andern zu seinem eigenen Schaden genützt (was hier nicht erwähnt wird: dass Oporin wegen des Druckens seine Professur hat aufgeben müssen).
Mit vollen Segeln ins Meer des Buchdrucks aufgebrochen, habe er seinen ersten Schiffbruch durch Winter erlitten: dieser habe, durch den Aufwand seiner Frau zugrundegerichtet, ausser seiner Offizin nichts hinterlassen (Oporins Schwager ist um 1546 gestorben, war aber auch selber recht prunkliebend, hat um 1540 sein Haus - wohl durch Conrad Schnitt - reich ausmalen lassen und bei der Wahl seiner Drucke ähnlich Oporin nicht in erster Linie auf Verkaufsträchtigkeit geachtet). Diese habe er für 700 wiederum anderswo geliehene Gulden (weit über ihren Wert hinaus) von Schuldnern zurückkaufen müssen (eine eigene Offizin hat Oporin seit 1542 besessen). Mit diesen Schulden aus dem vorangehenden Vertrag mit Winter und zusätzlichen aus dem Kauf seiner Offizin habe er sein Buchgeschäft begonnen. Darauf sei es durch eine Anleihe trotz allen Bemühungen nur noch schlimmer geworden. Denn er habe nicht nur von seinen Eltern nichts erhalten, sondern auch eine ansehnliche Summe von fast über 600 Gulden, die er vom Domherrn Ludwig Bär, einem Verwandten mütterlicherseits, sich schon vermacht erhofft habe, durch ein seltsames Unglück verloren: auf dem Weg nach Frankfurt habe er im Gasthof zu Mulberg nach deutscher Sitte sein Familienwappen ins Fenster einsetzen lassen. Der Maler habe die Wahrheit dargestellt, wie sie die Religion, diese geschminkt und mit einer Kutte bekleidet, mit Füssen trete. Als Bär das erfahren habe, habe er verärgert den Namen Oporins aus seinem Testament gestrichen (der Oheim Oporins, Domherr am Basler Münster und Professor der Theologie, war 1529 nach Freiburg übergesiedelt, dort als Sekretär des Erasmus tätig; gestorben 1554). Trotz all diesen Lästigkeiten habe Oporin sich bemüht, die Mühsale zu ertragen und zu überwinden, den Wissenschaften zu nützen, hierzu durch wiederholte Briefe und andere Leistungen das Wohlwollen der Gelehrten zu gewinnen. Sein Vater habe damals seine Kunst aufgegeben, um nicht Götzenbilder zu malen. Oporin habe ihn trotz seiner unzähligen Schulden unterhalten, so dass ihm nichts gefehlt habe, ebenso seine Schwestern (seine Mutter habe er früh verloren gehabt). Zwei Dinge zeigten sich besonders bei einem geschäftigen und behutsamen Drucker: das poiētikon - das Schöpferische - Vorlagen zu besorgen und zu drucken, und das metablētikon - das Tauschgeschick (ein Teil der Kaufmannskunst in Platos Sophistes) - die Drucke angemessen loszuwerden. Doch die Götter gäben - laut Homer - nicht alles: Oporin habe gewissenhaft und erfolgreich gedruckt, aber keinen Erfolg im Vertrieb gehabt. Ersteres bestreite niemand, und für den Druck heiliger Werke habe ihn Caspar Brusch einen Notar Gottes gegen den Antichrist genannt. Es sei das Verdienst Oporins, dass man die lateinische Bibelübersetzung des hochgelehrten und lauteren Castellio besitze: diesen Glaubensflüchtling mit seiner recht zahlreichen Familie habe er lange allein unterhalten, so wie er auch für andere Gelehrte immer ein sicherer Rückhalt gewesen sei (Castellio war seit Frühjahr 1545, nachdem er sich, als Flüchtling in Genf, mit Calvin überworfen hatte, bei Oporin als Korrektor tätig; seine Griechischprofessur erhielt er in Basel erst 1553).
Gegenüber den Arbeitern, die der Buchdruck erfordere, sei er über seine Verhältnisse freigebig gewesen, so dass er aus Mitleid, oft zu grossem eigenem Schaden, solche, die andere Drucker aus Furcht vor irgendeiner Unannehmlichkeit wegen schlechten Verkaufs entlassen gehabt hätten, aufgenommen und nicht selten deren über fünfzig beschäftigt habe. Tagtäglich sich mit diesen Menschen herumzuschlagen, habe riesige Sorgen bereitet (Martin Steinmann führt in seiner Monographie über Oporin, in der er natürlich auch einiges aus dieser Gedenk-Lobrede auf Oporin etwas relativiert, u.a. auch Einzelheiten aus einer Beschwerde der Basler Trucker gsellen an den Basler Rat aus dem Jahre 1539 an, die sich über zu geringen Lohn und überlange Arbeitszeiten - von vier Uhr morgens bis sieben Uhr abends - beklagt hatten, da nun einer so viel leisten müsse wie vor zehn oder elf Jahren ihrer zwei). Weiter habe kein Werk ohne seine Korrektur das Tageslicht erblickt. Und seinen Aufwand für die Drucke könne man aus der Aufopferung seines Vermögens ersehen. Es habe aber auch Leute gegeben, die mit ihrer Grosszügigkeit ihm in Notfällen rasch geholfen hätten. Ewiges Gedenken verdiene die Grosszügigkeit des hochgelehrten Rechtsgelehrten Ludwig Gremp, des hiesigen Stadtadvokaten (Ludwig Gremp von Freudenstein war zuvor Professor der Rechte in Tübingen gewesen, dann aus konfessionellen Gründen nach Strassburg übergesiedelt), und des hiesigen Rektors und Lehrers Johannes Sturm, die nach seinem Tod eine beträchtliche Schuld erlassen hätten. Das selbe habe der hochgelehrte Drucker Heinrich Petri getan, der 400 Oporin für den Buchdruck geliehene Gulden der Waise freigebig geschenkt habe.
Die andere Sorge des Druckers sei es, die gedruckten Bücher mit Gewinn loszuwerden, mit Gewinn für die Mühen und die Kosten. Dieser Teil sei eine willkommene und reichliche Entgelterin der Arbeit, erfülle die Kaufleute mit Freude für ihre Plackereien. Aber auch hier habe Oporin nur negative Erfahrungen gemacht. In Frankfurt sei er jedesmal durch die Grausamkeit der Geldverleiher wie in einer Folterkammer gepeinigt worden, so dass gerade in dieser Unbill seine Geistesgrösse und -kraft Lob, sein hartes Schicksal Mitleid verdiene. Er möchte ihm aber kaum eine Schuld daran zuweisen. Immerhin sei er zu sorglos hierin gewesen, in Bürgschaften und im Verleihen für andere sehr freigebig und hierin oft betrogen worden, so dass er bei Schuldnern über 8000 in allzu wenig sicheren Schuldscheinen ausstehend gehabt habe. Manche seien dann so niederträchtig gewesen, dass sie für ein Kapital von hundert Gulden zwanzig, ja dreissig Gulden Zinsen von ihm verlangt hätten. Trotz diesen Widerwärtigkeiten habe er von seinen hartnäckigen Bemühungen in nichts abgelassen. Diese gewaltigen und unermüdlichen Bemühungen, die Geisteswissenschaften zu fördern (iuvandis humanioribus disciplinis) belege jener Satz des Aldus, den er, seinem Unternehmen angepasst, an die Türe seines "Museums" angeschlagen gehabt habe: man solle sich kurz fassen, wenn man nicht wie Hercules beim erschöpften Altas die Last auf seine Schultern übernehmen wolle.
Zuweilen sei das Schicksal ihm gegenüber auch freundlich gewesen. So habe auch Kaiser Ferdinand seiner Rechtschaffenheit zuliebe gestattet, dass seine Waren undeklariert am österreichischen Zollhafen von Breisach vorbeifahren dürften. Doch Oporin habe, zu wenig auf zukünftige Vor- und Nachteile achtend, auch diese Gunst nicht genützt. Kurfürst Friedrich von der Pfalz habe in Bewunderung seiner Lauterkeit und seines Fleisses im Buchdruck ihn nach Heidelberg berufen, wo er sein Geschäft vielleicht besser hätte festigen können - wenn er nicht aus Heimatliebe die grosszügigen Bedingungen abgelehnt hätte.
Einst sei er geschäftlich zum Abt von Murbach Johannes Rudolf Stör gereist. Als er nicht sofort vorgelassen worden sei, sei er heimgekehrt und habe dem Abt einen bissigen Brief geschickt, dass er mit sich nicht Spott treiben und sich nicht zum Narren halten lasse; aber da Narren ja die Wahrheit sagten, sage auch er sie, und er sei gegen den törichten Hochmut der Höflinge losgezogen (die oft wegen der Ungeschicktheit der Mönche hochnäsig die Verwaltung an sich rissen). Oporins grösstes Bestreben habe, wie alle, die ihn gekannt hätten, wüssten, der Wahrheit gegolten; Lauterkeit und Ehrlichkeit hätten sein Wesen ausgemacht. Der Abt habe Oporin darauf freundschaftlichst eingeladen und das jährliche Honorar, das er dem hochgelehrten Sigismund Gelenius gewährt gehabt habe, nach dessen Tod (Frühjahr 1554) Oporin zur Ergänzung seiner - des Abtes - Bibliothek zukommen lassen (was heissen dürfte, dass er ihm garantiert hat, für diese Summe jährlich Bücher abzunehmen). Reich sei er an Freundschaften von Gelehrten gewesen, die ihn mit Briefen und Widmungen ausgezeichnet hätten, in der Erwartung, dass die Verbindung mit dem Namen Oporins ihre Arbeiten empfehle. So habe zum Beispiel Andreas Vesal sich lange freundschaftlich bei ihm aufgehalten, als er ihm seine Anatomie zum Druck anvertraut habe (sein reichillustriertes berühmtes Hauptwerk De Humani corporis fabrica vom Juni 1543). Auf seinen Hinweis hin habe er dann auch das Arionsymbol verwendet (Vesal ist spätestens Anfang Januar 1543 aus Padua/Venedig in Basel eingetroffen, hat sich zwischen 1. und 16. Januar unter dem Rektorat des Albanus Torinus an der Universität immatrikulieren lassen; im Januar 1543 ist das erste Arion-Signet Oporins in dem in diesem Monat abgeschlossenen Werk De veritate fidei Christianae des Johannes Ludovicus Vives zum erstenmal erschienen, dann in der Fabrica; zu einem Hilfsplan Hieronymus Wolfs für die Offizin aus dem Jahre 1563 s. unten).
In dieser mühseligen, schiffbruchreichen Weise habe Oporin über dreissig Jahre mit seiner zweiten Frau Maria Ficina (Fick/Nachbur) zusammen gelebt, die sich mit ihrer Verschwendungssucht dem keineswegs angepasst habe. Sie sei 1564 an der Pest gestorben, während er zur Messe in Frankfurt geweilt habe. Streit hätten sie nie gehabt. Allein habe er sein Haus mit den unzähligen Aufgaben und seiner Menge Gesellen nicht führen können, und so habe er nach einem halben Jahr ein drittes Mal geheiratet, die tüchtige und wohlhabende Elisabeth Holzach, die Witwe des jüngeren Johannes Herwagen, der an der selben Pest gestorben sei (ebenfalls aus dem Kreis der Drucker u.a. Hieronymus Curio mit Familie und Marcus Hopper). Die Vereinigung der beiden Offizinen habe ihm noch mehr Lasten gebracht. Durch diese Mitgift sei er, als er nach den jahrelangen Mühsalen habe Luft schöpfen wollen, nochmals ins Meer des Buchdrucks hinausgefahren. Doch dieses Gedeihen habe ihr plötzlicher Tod unterbrochen: nach einer Kur in Baden sei sie nach viermonatiger Ehe in Basel gestorben, ein schwerer Schlag für Oporin, denn mit ihr habe er ein glückliches Eheleben kennengelernt und ihr Vermögen habe sie gern den Bemühungen ihres Gatten um öffentlichen Nutzen zur Verfügung gestellt gehabt, ihm ihre Treue zu beweisen und mit ihm einig in der Förderung der Wissenschaften. Den Schmerz über den Verlust seiner Heroïssa habe ihm seine vierte Gattin, ihr gleich an Klugheit, Güte, Treue, tragen helfen, die Tochter Bonifacius Amerbachs, Witwe des Rechtsgelehrten Ulrich Iselin, Faustina, die ihm zudem einen Sohn geschenkt habe. In Abwägung des Geschäfts und des Alters Oporins habe sie ihn dann inständig gebeten (es ist bekannt, dass auch ihr Vater Amerbach darauf gedrängt hat), sich durch den Verkauf der Offizin zu entlasten. Nur schwer habe er ihren Bitten nachgegeben, der Meinung, den Posten, auf den ihn Gott gestellt habe, nicht leichtfertig aufgeben und den öffentlichen Nutzen nicht der privaten Musse hintanstellen zu dürfen, da der nahe Tod von selber seine Druckertätigkeit beenden würde. Schliesslich habe er eingewilligt und die Offizin, für eine Summe weit unter seiner Berechnung, verkauft. Bald darauf habe er, an seinem eigenen 61. Geburtstag, am 25. Januar 1568, seinen Sohn Emmanuel bekommen, ein Omen seines baldigen Todes. Aus Freude über diesen einzigen männlichen Nachkommen habe er in keinem seiner Briefe an Gelehrte seinen Oporinulus zu erwähnen vergessen. Aber auch jetzt habe man ihn nicht in Frieden gelassen und so sein Ende beschleunigt. Im fünften Monat nach der Geburt seines Sohnes habe er sich mit Katarrh und Kopfschmerzen niedergelegt, nachdem er bis dahin ausser einem Schlagfluss auf einer Reise zu den Veitmoser (die mit einem Delphin mit tausend Joachimstalern Arion 1558 nahe vor dem Untergang aus den Händen der Piraten gerettet hätten: der 1506 in einfachen Verhältnissen geborene Christoph Weitmoser hatte es in Gastein zu einem der reichsten Bergwerksherren gebracht und 1558 Oporin mit 1000 Talern geholfen)). Nach zwanzig Tagen sei er am 6. Juli 1568 um die neunte Morgenstunde mit der Geduld und dem Gottesglauben, den er sein Leben lang bewiesen habe, aus diesem Leben der Mühsale geschieden. Sechs Tage zuvor habe er als Zeichen seines Todes im Traum eine automatische Uhr über seinem Bett gesehen, deren Gewicht, das sie in Gang halte, nach dem Stundenschlag auf seine Brust gefallen sei und ihn geweckt habe, und dabei habe er wie einen süssen Klang vernommen.
Unter Geleit sämtlicher Professoren sei er im Münster in Gesellschaft der berühmtesten Männer - des Grynaeus, Oecolampads, Münsters und anderer, die durch das Weiterleben ihrer Werke nie vergessen würden - begraben worden. Die Leichenpredigt habe der verehrte hochgelehrte Theologe Simon Sulzer (er war Professor der Theologie und Antistes der Basler Kirche) gehalten. Alle Rechtschaffenen hätten um ihn getrauert, aber auch die Geldverleiher, die ihn im Leben verbrecherisch ausgeplündert hätten, selber - neben seiner Herkunft aus armen Verhältnissen - Ursache seiner Schulden gewesen seien, deren Zahl aber auch die Verschwendungssucht seiner zweiten Frau vermehrt habe, hätten sich nicht geschämt, ihn noch nach seinem Tod zu beschimpfen. Möge die Nachwelt dankbar mit ihren Lobpreisungen den Ruf Oporins bestätigen, der mit so geringem Vermögen und aus so kleinen Anfängen heraus im Buchdruck so grossartig zu sein vermocht habe.
Im Anschluss an diese Gedächtnisrede findet sich, vor dem Verzeichnis der Drucke Oporins, ein Gespräch Celio Secondo Curiones mit Oporin über den Tod abgedruckt, das diese im Anschluss an die Abdankung für Rachel Brand, wohl am 14. Juni 1568, also kurz vor Oporins Krankheit, geführt hätten und in dessen Verlauf Oporin, als er die Inschrift am Grabe des Sohnes Celios Augustinus "Ianua Vitae" gelesen habe, sich sein Grab in Gesellschaft der drei Töchter Celios, seines Augustinus sowie Castellios, Isingrins und Frobens gewünscht habe.
Die Entstehung, die Probleme der Finanzierung - vor allem durch die Fugger - und den geschäftlichen Misserfolg - vergrössert noch durch natürlich billiger verkäufliche Nachdrucke allein der lateinischen Übersetzungen in Paris und Frankfurt - der buch-, wissenschafts- und kulturgeschichtlich wohl bedeutendsten und verdienstvollsten Leistung Oporins, der Drucke der byzantinischen Historiker, hat in seinem Beitrag zur Festschrift für den damaligen Direktor der Basler Bibliothek Karl Schwarber 1949 dessen späterer Nachfolger Fritz Husner ausführlich untersucht; unter anderem einen Rettungsversuch der Offizin im Jahre 1563 durch den mit Oporin befreundeten Augsburger Gräzisten, Fuggerschen und Stadtbibliothekar Hieronymus Wolf hat Martin Steinmann in seiner Dissertation über Johannes Oporinus von 1966 beschrieben, beide vor allem anhand des über zwanzigjährigen Briefwechsels Oporins mit Wolf von 1547 bis 1568 (allein in Basel sind fast 150 Briefe Wolfs an Oporin aufbewahrt): "Der Drucker ist recht zuversichtlich an die Frühlingsmesse nach Frankfurt gezogen. Dort aber zeigte sich rasch seine wahre Lage: er wurde zahlungsunfähig. Der kalte Schrecken muss ihn gepackt haben, als er erkannte, wie es um ihn stand. Er dachte daran, sein Geschäft aufzugeben, nach Frankfurt zu ziehen und sich dort still und bescheiden sein Leben damit zu verdienen, dass er einzelne auserlesene Werke druckte. Hieronymus Wolf schrieb zwar aus Augsburg, verständige Männer billigten diesen Plan, und Oporin dürfe sich mit ruhigem Gewissen zurückziehen, habe er doch bereits in seiner bisherigen Tätigkeit Gryphius, Stephanus, ja Aldus übertroffen. Doch der Basler fasste bald neuen Mut. Vorerst bewährte er wieder sein Geschick im Umgang mit Gläubigern: er kam frei und konnte heimkehren. Damit hatte er eine Galgenfrist bis zur Herbstmesse gewonnen und konnte einen Ausweg suchen. Vor allem brauchte er Geld, denn, wie Wolf ihm erklärte, wenn er sich mit den Finanzleuten nicht arrangieren könne, werde er auch in Frankfurt nicht sicher sein.
Wenn Oporin nicht aufgeben wollte, war es das Wichtigste, den Betrieb in Gang zu halten und sich möglichst wenig anmerken zu lassen. Er war so unternehmend wie je und schrieb an Hubert, wenn ihn Satan nicht hinderte, wollte er so viel produzieren wie fünf oder sechs andere Drucker zusammen. Anfangs Juni arbeitete er wieder mit allen Pressen, zum Teil für Herwagen und Petri. - Schlimm stand es mit den Finanzen: Wolf schrieb, die Augsburger Handelsherren wollten nichts geben. Die Lage der Stadt habe sich in den letzten drei Jahren gründlich verändert; die Herrscher von Frankreich, Spanien und Portugal hätten enorme Summen erhalten und zahlten rein nichts zurück; die alte Freigebigkeit sei deshalb eingetrocknet, er könne ihm gar keine Hoffnung machen. Ob der Rat die Bibliothek des Druckers kaufen wolle, sei auch noch ungewiss, man sei ja noch nicht einmal sicher, dass sie nicht von den Gläubigern gepfändet werde. Wenn möglich solle aber Oporin einen Katalog schicken und die Preise mitteilen, man halte jeweils die Hälfte des Neuwertes für angemessen. Die Augsburger Bibliothek sei übrigens recht gross, nur habe man in den letzten sechzehn Jahren nichts mehr angeschafft. - Die Verhandlungen zogen sich noch längere Zeit hin. Zuerst fanden die Augsburger Oporins Preise zu hoch, sie wollten von dem ausgehen, was die Drucker bekamen, nicht von dem, was die Händler verlangten. Dann zeigte sich, dass die Bücher, die man wirklich hätte anschaffen wollen, kaum dreihundert Gulden eingebracht hätten, und die Sache verlief sich. Wolf schickte das Verzeichnis zurück" (S. 105).
Ein anschauliches Bild seiner in erster Linie wissenschaftlichen, erst in zweiter kaufmännischen Überlegungen und Bemühungen geben sein Vorgehen bei seinen kleineren Aristotelesdrucken und seine eigene Widmung zu deren letztem: In Paris waren von 1540 bis 1552 etwa ein Dutzend Drucke mit Übersetzungen einzelner Schriften des Aristoteles in lateinischen Übersetzungen des französischen Benediktiners Joachim Périon erschienen. Oporin hat sie sämtlich recht bald nachgedruckt, und seine Absichten dabei erfahren wir 1554 in seiner Widmung des Organon. Als erstes druckt er noch im selben Jahr 1540 die Nikomachische Ethik, die 1540 in Paris erschienen war (weitere Drucke dieser Übersetzung in Paris 1542 und 1548, bei Oporin 1545 und 1552); 1542 im Jahr seiner zweiten, von Hieronymus Gemusaeus besorgten lateinischen Gesamtausgabe in verschiedenen Übersetzungen sowie derjenigen der Institutiones des Porphyrius mit Categoriae und De interpretatione (Nr. 151), erscheint bei seinem ihm geschäftlich verbundenen Schwager Robert Winter ein weiterer Druck dieser Übersetzung (Nr. 126), bei ihm selber eine andere neue Übersetzung der Ethik mit verschiedenen Kommentaren; 1543 und nochmals 1544 erscheinen bei Oporin die Topica mit den Reprehensiones (Elenchoi) und dem Axiochos (zuvor Paris 1542, Topica allein auch schon 1541), 1544 und nochmals 1549 die Politik (Paris 1543), 1551 die Rhetorik in einer andern Übersetzung (von Périon nicht übersetzt), 1552 und nochmals 1553 die Physik (Paris 1550), 1553 gleich sechs weitere solcher Einzeldrucke: De anima (Paris 1549 und 1550), die kleinen naturwissenschaftlichen Schriften (Paris 1550), De generatione et corruptione (Paris 1550 und 1552), De coelo (Paris 1550 und 1552), De generatione animalium, die Meteorologica (Paris 1552). 1554 druckt Oporin dann das Organum, das nach Einzeldrucken 1548 in Paris gesamthaft in Übersetzungen Périons erschienen war, zwischen den griechischen Ausgaben der Basler Professoren Grynaeus und Hospinian ebenfalls gesamthaft nach und widmet den Druck am 1. März 1554 dem Abt von Murbach und Lure Johann Rudolf Stör. Die Widmung musste, nachträglich, auf einer zusätzlichen Lage a mit einem neuen Titelblatt vorangestellt werden, nachdem die Ausgabe, als Nachdruck, zuerst offenbar ohne eine solche geplant worden war und die Übersetzungen sogleich auf Blatt a2 des Textdrucks nach dessen Titel beginnen.
Zu Beginn seiner Widmung preist Oporin die Gelehrtenwelt glücklich, dass nun endlich, vom griechisch und lateinisch hoch gebildeten Joachim Perionius geschaffen, die lange begehrte lateinische Übersetzung des Organum vorliege. Es habe vorher Einzelteile gegeben, die er gedruckt gehabt habe. Jetzt habe er das Gesamtwerk drucken wollen, damit man von ihm mit der selben Annehmlichkeit die gesamte Philosophie des Aristoteles zur Verfügung habe. Von den drei Teilen der Philosophie habe er die des Lebens und der Sitten und die der Natur schon früher herausgegeben (s. oben). Das allen Künsten gemeinsame Werkzeug der Lehren, darum Organon geheissen, erscheine jetzt in seinem Namen. Er könne die Verdienste des Abtes ihm und der ganzen Gelehrtenwelt gegenüber bezeugen: er habe sich auf seine Bitten und seinen Rat hin bewegen lassen, mit grossen Kosten eine Papiermühle bauen zu lassen, aus der er schon seit einigen Jahren einen grossen Teil des bisher verwendeten Papiers geliefert erhalten habe. So gestehe er, dass ein grosser Teil der Bücher aus seiner Offizin seiner Grosszügigkeit zu verdanken sei. Er habe den weitaus besseren Weg zu unsterblichem Gedächtnis gewählt, als wenn er dieses mit unzähligen Kolossen, Burgen oder andern Denkmälern zu erreichen gesucht hätte. Nichts widerstehe dem Altern so sehr wie die Wissenschaften und die Künste. Daher diese Widmung zu seinem Ruhm. Wer je etwas Nennenswertes über Dialektik geschrieben habe, habe hieraus seine Bächlein abgeleitet und seine Gärten bewässert: antike, jetzige und mittelalterliche Griechen, Barbaren und Lateiner. Ohne Aristoteles gebe es keine Methodik in der Dialektik, weder in der Erfindung - Topik und vorangehende Bücher - noch im Entscheiden - den beiden Analytica -, was er nach der Natur zeige. Im folgenden weist Oporin kurz auf das Wesentliche der einzelnen Schriften des Organum hin und dass Porphyrius ihm gleichsam den Griffel für die Lyra der Logik beigesellt habe. Dies alles habe es bis jetzt in schlechtem und sinnwidrigem Latein gegeben, auch mit weitläufigen Kommentaren nicht verständlich. Nun rede es dank Perionius klar, anmutig, verständlich, lateinisch, jetzt ohne Lehrer leichter verständlich als vorher mit seiner Hilfe. Dazu gebe es von ihm Anmerkungen, in denen er seine Übersetzungen rechtfertige, besonders die schwierigen Stellen, durch Vergleiche des Lateins mit dem Griechischen, Textverbesserungen. So werde gleichzeitig das Griechische und das Latein erklärt und widerlegt, dass lateinische Erklärungen nicht möglich seien. Und man lerne, sich rein lateinisch auszudrücken und die Methode, elegant aus dem Griechischen zu übersetzen (und um diese Methode ist es Périon ja auch besonders in seinem Geleitbrief zu seiner Übersetzung der Nikomachischen Ethik gegangen: s. Nr. 126; Oporins Druck von 1554 konnte 1990 erworben werden: P b 1228).
Jociscus hat als Beispiel eines verdienstlichen Werkes Oporins, sowohl was den Druck wie was die Unterstützung des Herausgebers und Übersetzers, des reformierten französischen Emigranten Sebastian Castellio, betrifft dessen neue lateinische Bibelübersetzung aus dem Hebräischen und Griechischen mit Annotationes und neuen feinen Nachbildungen der traditionellen erläuternden Illustrationen (vom Strassburger David Kandel?) samt Bildlegenden angeführt, die im März 1551 erschienen ist, um eine jüdische Geschichte nach Josephos erweitert nochmals 1554 bei Oporin und 1556 bei Oporin, Ludwig Lucius und Michael Martin Stella. Castellio hat das Werk im Februar 1551 dem jungen (und dann jung verstorbenen) König Edward VI. von England gewidmet, in dem die Reformierten aller Länder den grossen Befreier seines Reiches von der Herrschaft des Katholizismus begrüssten, was man auch deutlich aus der Widmung ersehen kann. 35 Jahre nach der ersten griechisch-lateinischen Ausgabe des zahlreich nachgedruckten Neuen Testaments durch Erasmus von Rotterdam bei Froben, gut fünfzehn Jahre nach der hebräisch-lateinischen Ausgabe des Alten Testaments durch den 1551 noch voll in Basel tätigen Sebastian Münster bei Johannes Bebel, Michael Isingrin und Heinrich Petri, ein Jahr nach der griechisch-lateinischen Oktavbibel Nicolaus Brylingers sollte auch diese neue philologische und theologische Übersetzung einen Einschnitt in der Bibelkenntnis bilden; daher die Formulierung des Jociscus, dass man - Jociscus und seine Zeitgenossen und die Nachfahren - sie einem beneficium Oporins verdanke. Freunde hätten ihm empfohlen, die Übersetzung aus drei Gründen ihm zu widmen: erstens stehe niemand die Widmung der heiligen Schrift besser zu als ihm als dem König, dessen Reich ein Asyl sei für die, die wegen ihres Studiums und ihrer Verteidigung der heiligen Schriften verfolgt würden; zweitens da er eine solche Übersetzung kürzlich in Auftrag gegeben habe, diese aber durch den Tod eines der Übersetzer nicht zustande gekommen sei; drittens da er ganz besonders Latein studiere. Er habe sich darum bemüht, dass die Übersetzung getreu, lateinisch und verständlich sei. Davon seien das erste und das dritte am wichtigsten, da es um die Sache gehe und die Evangelien ohnehin nicht mit Redekunst verfasst seien. Es handle sich darin aber um Göttliches, schwer Verständliches. Besonders in der Gegenwart sei die Ungewissheit gross, wie die Streitigkeiten zeigten und die Unzahl von Büchern mit diametral entgegengesetzten Ansichten. Die eine Wahrheit könne nicht diese Widersprüche zeugen, nur Unwissen könne das. Doch aus Mangel an Gelehrsamkeit könne dieses nicht kommen, denn noch keine Zeit sei so reich an dieser gewesen. Seine Ursache müssten Sünde und Gottlosigkeit sein. Gottesliebe und Gottesfurcht seien nötig, wie schon die Propheten gefordert hätten, so viel Bemühung um ihn wie es sie um alle möglichen Dinge gebe. Dann komme das Goldene Zeitalter. In der Folge malt Castellio diese versprochene glückselige christliche Zeit mit Bibelzitaten aus Propheten und Apokalypse aus, deren Gotteskenntnis und -gehorsam, die er bisher aber nicht erreicht sehe. Schädlicher als die Kriege mit dem Schwert seien die mit Worten und Federn. In der Bemühung um Christus würden andere verfolgt, werde ihnen Übles angetan. Statt der Liebe herrsche Hass. In dieser Zeit müsse jeder darauf achten, dass er nicht selber in diese Fehler falle, nicht andere verurteile. Zudem sei es absurd, einen geistigen Krieg mit irdischen Waffen zu führen. Tugenden, Lehre, Geduld, Bescheidenheit, Fleiss, Sanftmut, wahrhafte Religiosität und Reinheit seien vonnöten.
Einem folgenden kürzeren Hinweis an den Leser lässt sich Castellios Vorgehen entnehmen: er habe aus dem Hebräischen übersetzt (1553 - erst - ist er in Basel, nach dem Tod Münsters, professor Hebraicus für Griechisch geworden), das hebräisch nicht Überlieferte aus dem Griechischen oder altem Latein und gegenseitig ergänzt, wobei er diese Stellen gekennzeichnet habe; syrisch - was er nicht beherrsche - Überliefertes habe er andern Übersetzungen entnommen. Er weist auf die Schwierigkeiten einer adäquaten Wiedergabe in einer andern Sprache hin, auf die Unkenntnis alter Ausdrücke, wie sie sich ja auch z.B. im alten Latein Catos fänden. Schwierigkeiten und Mehrdeutigkeiten habe er am Rand erklärt. Sein Geständnis unverstandener Stellen wolle nicht Verständnis alles andern bedeuten, das überdies auch nur das Äussere betreffen könne. Und ein weiteres Mal weist er, als kurze Einleitung der Annotationes, auf Schwierigkeiten und Eigenheiten jeder Übersetzung hin, im besondern auf seine vom Bisherigen abweichende möglichst adäquate und verständliche Wiedergabe hebräischer Eigennamen. Um besserer Verständlichkeit willen hat Castellio z.B. der seitengrossen feinen Darstellung der Vision Ezechiels (Sp. 107-110) mit der Bemerkung, dass in dieser Darstellung seine Absichten nicht klar genug wiedergegeben werden könnten und er darum noch eine primitive beigefügt habe, eine rein schematische Darstellung mit Kennbuchstaben folgen lassen, die ihrerseits die figürliche Darstellung deuten helfen kann.
So führen uns diese Widmungen und Vorreden mitten in die Jahre um die Jahrhundertmitte mit konfessionellen Streitigkeiten und Verfolgungen hinein, mitten in die Bemühungen einer neuen - und doch auch schon für Erasmus gültigen - Bibelphilologie, mitten in das zentrale theologische und menschliche Anliegen Castellios, das ihn zunächst aus Frankreich, dann aus Genf hat flüchten lassen: die menschliche kritische Einstellung gegenüber sich selber und theologische Toleranz.
Das Basler Exemplar der Biblia, Interprete Sebastiano Castalione. Una cum eiusdem Annotationibus, auf deren Bedeutung der Typographus den Leser auf der Titelseite hinweist - dass er in dieser neuen Übersetzung getreu die Wahrheit des hebräischen und griechischen Sinns des Alten und Neuen Testaments wiedergegeben finde, in reiner lateinischer Sprache und verständlich - hat Sebastianus Castalio Bonifacius Amerbach geschenkt (F G III15).
BE V 5: Geschenk der Verwaltung der Frey-Grynaeischen Bibliothek, 1891. Im Juni 1570 von Johann Lucas Iselin erworben.
Bibliothekskatalog IDS
Signatur: BE V 5