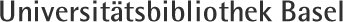GG 227
Demosthenis & Aeschinis Orationes atque Epistolae, quae ad nostram aetatem pervenerunt, omnes: partim recens conversae, partim diligenter recognitae: summo adhibito studio, ut sententiae veritas cum Latini sermonis puritate, quantum quidem fieri potuit, coniungeretur: & Demosthenicae atque Aeschineae dictionis genius aliquo modo appareret: Per Hieronymu VVolfium Oetingensem... Basel: Johannes Oporin [Sommer 1554]. 4 Bde. 8°.
Wohl im September 1554, also wohl vier Jahre nach der ebenfalls undatierten Folioausgabe seiner Übersetzung der Reden und Briefe des Demosthenes (GG 226) erscheint dieses Werk Wolfs nochmals beim selben Drucker Oporin, nun in vier (wohl meistens in zwei gebundenen) Oktavbändchen. Da es sich in diesem Format mehr um eine Leseausgabe handelt, die zudem potentielle Käufer nicht zu teuer zu stehen kommen sollte, ist der Kommentar Ulpians aus dem vierten Band von 1550 weggelassen, der biographische Vorspann Plutarchs usw. aus diesem Teil in den ersten hinübergenommen, ebenso die Gnomologien und das Annotationes-Specimen; die 1550 zum Vergleich als fünfter Teil beigegebenen z. T. älteren Übersetzungen u.a. des Camerarius, Melanchthons, Hegendorfs, Lonicers wurden ebenfalls weggelassen. Anderseits hat Wolf eine Übersetzung sämtlicher Reden des Aeschines beigegeben, die hier zum erstenmal vollständig lateinisch erscheinen, sinnvoll jeweils bei den demosthenischen Gegenreden eingefügt, im 2. Teil. Dadurch erscheinen die meisten Reden des Teils 2 von 1550 nun im dritten, die des Teils 3 von 1550 im nun letzten, vierten Teil. Die Widmungen der Gesamtausgabe und der übernommenen Gnomologien (neu der Briefwechsel Wolfs mit Carinus vom August 1550) sind mitübernommen, doch zusätzlich hat unsere Ausgabe eine zweite Gesamtwidmung, ebenfalls an Johann Jacob Fugger, dessen Sekretär und Bibliothekar Wolf seit 1551 ist, erhalten, datiert aus der Fuggerschen Bibliothek von seinem Geburtstag, dem 13. August 1553, und Band 2 - mit u.a. den neuen Aeschinesübersetzungen - eine neue Widmung an den selben Herrn und Gönner aus dessen Bibliothek vom 15. Mai 1554, während die kürzeren Widmungen an Fugger von Band 3 und 4 undatiert sind.
In seiner neuen Gesamtwidmung an Fugger ("an den selben"), die uns manchen Einblick in die Kleinarbeit in der Offizin gewährt, weist Wolf zunächst auf das unterschiedliche Nachleben von Schriftstellern und Dichtern bzw. ihrer Werke hin: Sei es durch eine Stimmung der Menschen, sei es durch den Geist der Bücher: die einen stürben vor ihren Autoren, andere pflanzten sich, immer wieder nachgedruckt, in die Nachwelt fort. Und das sei nicht nur die Lage in der Gegenwart, sondern aller Zeiten, und nicht nur der jeweils eigenen Schriften eines Autors, sondern auch der Übersetzungen aus fremden Sprachen. Die Hoffnung auf Dauer und Verbreitung einer Schrift entspreche ihrer Anerkennung durch die Zeiten; und auf ihre Weise schauten diejenigen Drucker und Buchhändler nicht auf die Gegenwart (denn Unerfahrenheit und Neuerungssucht stünden oft der Wahrheit im Wege), sondern bestens auf Langlebigkeit, die die alten durch die Zeit bewährten Autoren sich zu eigen gemacht hätten. Er tadle die nicht, die gewisse neue Dinge, vor allem gelehrte und den Studiosi nützliche, schrieben: sie seien sogar für ihre Versuche lobenswert. Doch er vermöge zu wenig auf diesem Gebiet; er hätte gegen seinen Willen dazu gezwungen werden müssen. Wohl überlegt habe er sich die Übersetzung der beiden grössten griechischen Redner ausgesucht; das Schicksal habe seinen Plan gebilligt. Nach Ausverkauf der ersten Drucke seien beide Werke unter Zustimmung der Gelehrten wieder in die Presse zu geben gewesen. Kaum habe er sich von den Anstrengungen der beiden Ausgaben erholt gehabt, habe er die Aufgabe der Durcharbeitung nicht ablehnen dürfen, da keiner eine Arbeit so gut leiste, dass er sie nicht noch verbessern könne. Wie man Kinder nicht nur auf die Welt bringe, sondern auch zu erziehen versuche. Bisher habe er für seine Arbeiten allerdings einen Lohn erhalten, der den Willen zu nützen eher auslösche als entzünde. Ein freier Geist richte sich mehr nach der Pflicht als nach dem eigenen Vorteil. An Entschädigung durch irgendeinen kleinen Ruhm für die Plackerei denke kein ernsthafter Mensch. Die Bescheidenheit der Geister und die Ohnmacht der Wissenschaft enttäusche nicht selten eine solche Hoffnung. Viele zögen deshalb ein gefahrenloses Leben im Dunkel einer unsicheren Bekanntheit vor. Die Durcharbeitung des Isokrates, mit dessen Übersetzung er seine Erstlingsarbeit geboten habe, habe ihn so verändert, dass man ihn kaum wiedererkenne. Der Grund sei am betreffenden Ort angegeben. Die Gedanken, das Wichtigste für einen zuverlässigen Übersetzer, seien allerdings in beiden Ausgaben unverändert wiedergegeben. Deshalb werde ihn wohl niemand tadeln. Bei Demosthenes sei dies anders: bei dessen Übersetzung sei er ehrfürchtiger und sparsamer vorgegangen, der Sprache des Demosthenes fast abergläubisch gefolgt. Dadurch sei der lateinische Text manchmal kaum weniger dunkel als der griechische. Dazu seien die Druckfehler, mehr und schwerere als erwartet, gekommen. Zu wenig habe, wie sich zeige, die Sorgsamkeit Oporins und seine Anwesenheit gegen die Nachlässigkeit und Gleichgültigkeit der Arbeiter genützt, obwohl ein gewisser Teil der Schuld auf die Unordentlichkeit der geschriebenen Vorlage abgewälzt werden könne. Er sei durch schlechtes (das zeigen auch seine Briefe) und wirres Schreiben, unterschiedliches Streichen und Einfügen selber schuld (aber er verzeihe sich), dass seine Bücher zuweilen nicht so gut gedruckt würden. Denn für Oporin, bei dem er mehrere Monate gewohnt habe, könne er bezeugen, mit welcher Sorgfalt er handgeschriebene Archetypen lese, anzeichne, zum Satz herrichte, verbessere, bevor sie gedruckt (bzw. gesetzt) würden. Diese Fehler habe er in dieser Ausgabe alle entfernt, und er glaube, dass jetzt, da gleichsam das Eis durch den ersten Versuch gebrochen und der Weg gewiesen sei, ein ähnliches Unglück vermieden werden könne. Dies sei der erste Nutzen dieser Ausgabe, ausser dass diese Handbuchform (Oktavformat) den Verhältnissen der Studiosi, besonders der armen, besser angepasst sei und von den Wohlhabenderen ohne Schaden zur grossen Ausgabe, die an Kommentaren und fremden Übersetzungen reicher sei, hinzuerworben werden könne. Weiter habe er zu wenig deutlich Erklärtes oder holprig Ausgedrücktes (was in der Nachbildung der griechischen Formulierung schwer zu vermeiden sei) geglättet, wie er hoffe, und durchsichtiger gemacht. Auch sei einiges erklärt, was ihm vorher noch zweifelhaft gewesen sei. Dennoch gebe es (um die Wahrheit nicht zu verschweigen) einiges Verderbtes oder sonst Dunkles, das er auf keine Weise habe wiederherstellen und erklären können. Man möge ihm das verzeihen. Wie Freigebige gerne teilten, so würden Ehrliche, was ihnen fehle, von Reicheren erbitten. Er gehöre nicht zu denen, die behaupteten, alles zu wissen: so habe er im Isokrates an holprigen Stellen seine Zweifel am Schluss geäussert und im Demosthenes das Griechische seinerzeit am Rand beigefügt sowie am Schluss seiner Annotationes zur ersten Olynthischen Rede korrekte Leser gebeten, sich nicht zu scheuen, ihm ihr Urteil zu senden. Was bisher, weshalb auch immer, niemand getan habe; und auch die hätten ihn im Stich gelassen, die er persönlich um ihre Kritik (censura) gebeten habe und darum, ihm und den andern Liebhabern der beiden Sprachen bei der Erklärung dunkler Stellen zu helfen (eine solche schriftliche Censura vom April 1548 findet sich von Castellio in Wolfs Isocratis Sententiae von 1572 zu Erstausgabe und Gnomologien vom August 1548 (GG 216) ). Dafür hätten faule, freche Winzlinge, wie allen besseren Männern, ihre hündische Beredsamkeit auch gegen ihn geübt. Das störe ihn aber nicht, zufrieden mit seinem Gewissen und im Vertrauen auf eine gerechtere Nachwelt. Nach bestem Können habe er das Seine geleistet; Gott möge bewirken, dass es gemäss seinem Wunsch nütze. Gegen Verleumder tröste er sich mit Alexander dem Grossen, dass es königlich sei, verleumdet zu werden während man Gutes tue. Zudem entstünden solche Übelreden weniger aus Missbilligung des Werks als aus Eifersucht und Neid. Er würde sich freuen, wenn die Leute statt zu tadeln verbessern würden. Der Erfolg seines mühsamen Übersetzens und der arbeitsreichen Textherstellung sei dem Urteil der Leser zu überlassen. Je billiger dieses sei, umso eifriger werde er sich an die Kommentare zu Demosthenes und Isokrates machen. Billigkeit sehe er im Vergleich der wenigen kleinen Fehler und Unwissenheiten mit der Menge der wohl guten Formulierungen und sorgfältigen Erklärungen. Sein, Fuggers, Urteil kenne er, nachdem er schon seinen früheren, weniger vollkommenen Versuch gut aufgenommen habe, und dies, als er seine Studien noch nicht so gut gekannt habe. Da könne er an seiner Aufnahme nach der neuen Arbeit und der ansehnlichen Beigabe der Reden und Briefe des Aeschines, die vieles bei Demosthenes erklärten und dem Leser grossen Nutzen und Genuss brächten (um von den Annotationes zu schweigen), nicht zweifeln. Zumal er in längerem häuslichem Umgang (als sein Sekretär und Bibliothekar seit 1551) seinen Charakter und seine Humanität freudig kennen gelernt habe. So vertraue sich Demosthenes, nun mit Aeschines versöhnt, ein zweites Mal seinem Patronat an. Wenn er mit seinem scharfen Urteilsvermögen ihn für gut befände, würde er fremde Verleumdungen nicht beachten. Wenn diese wider Erwarten ausblieben, so sei das weniger seinem Fleiss als seiner, Fuggers, Grosszügigkeit zu verdanken, dank der er mehr Ruhe gehabt habe, das Werk auszufeilen. Eine besondere Vorrede hat Wolf noch den Exordia beigegeben (S. 219-221), in der er auf deren unterschiedliche Reihenfolge in der besseren Ausgabe des Bruciolus gegenüber der Aldina und seiner Hervagiana - da er damals keinen anderen Text (codicem) zur Verfügung gehabt habe, deren Richtigkeit er nicht entscheiden könne, deren Text er aber nochmals verbessert habe.
Die fast zehnseitige Widmung des zweiten Teils von den Iden des Mai 1554 beginnt mit einer Rechtfertigung der Politik des Demosthenes: Im ersten Teil habe man neben anderem die Reden gefunden, die Demosthenes gegen Philipp und Alexander von Makedonien gehalten habe. Der scharfsinnige und in die Zukunft blickende Redner habe vorausgesehen, nach Betrachtung der Herrschernaturen und Erwägung der Unvereinbarkeit von Volks- und Königsherrschaft, dass die Makedonier nach der Unterwerfung der übrigen Provinzen unmöglich mit den Grenzen ihres ererbten Reiches zufrieden sein würden, bis sie ihre athenischen Rivalen aus dem Wege geräumt oder unterworfen hätten. So habe er nach seiner Überzeugung nicht nachlassen, der Trägheit und Feigheit seiner Mitbürger nicht nachgeben und sich vor den Angriffen der Verräter nicht fürchten dürfen, sondern das Volk aus Müssiggang und Luxus zur Nachahmung der Vorfahren antreiben, die Unverfrorenheit der Verräter im Zaum halten und Verteidiger überall werben müssen, um die Tyrannis der Makedonier zu verhindern und die jahrhundertealte Freiheit der Griechen zu bewahren. Dies bezeugten seine Reden und sein Leben. Da dies durch seine Arbeit nun auch Lateinern offenstehe, brauche er sich darüber nicht weiter auszulassen, zumal auch Plutarch und Pausanias es bezeugten. Einzig gegen die Vorwürfe, er habe aus Ruhmsucht, persönlichem Hass gegen die Makedonier und infolge persischer Bestechung so gehandelt - was bei vielen Beweggrund sei - müsse er ihn noch verteidigen. Verbrecherische Naturen würden häufig grosse Männer, um ihren eigenen Ruf zu verdecken, solcher Dinge beschuldigen. In Privatprozessen des Demosthenes käme Ähnliches vor, doch das sei als etwas Menschliches zu entschuldigen. So hätten grosse Geister (nach Plato) manchmal auch grosse Fehler. Dem Staat gegenüber finde sich bei Demosthenes nichts dergleichen. Freilich liebe er Demosthenes und preise ihn als seinen Lehrer (dies allerdings nur in der Sprache, seine Beredsamkeit fasse sein Geist nicht), der etwas von seinem Ruhm ihm zuteil werden lasse (denn nirgends lese man Demosthenes sonst lateinisch, was ehrliche Männer ihm eingeständen), doch gegen die Wahrheit anzukämpfen liege ihm fern. Viel ungerechter seien diejenigen, die die Ratschläge nach dem Erfolg beurteilten; denen hätten aber auch schon Demosthenes in der Kranzrede und Cicero im vorletzten Brief an Lentulus geantwortet. Und nirgends genüge die Intelligenz des Menschen, schicksalhaftes Unglück zu verhindern und Glück herbeizuholen, wie bei den Steuermännern im Sturm, den Bauern gegenüber Hagel, Blitz und Regengüssen. Und wie grosse Flüsse nicht einen geraden Lauf nähmen, so ergriffen kluge Menschen oft nicht das am meisten Erwünschte, sondern das Beste, das sich ihnen biete. So solle, wer sein Vaterland liebe, wie wer sich um Redekunst bemühe, die vorangehenden Reden des Demosthenes lesen, was für nicht allzu beschäftigte Staatsmänner nützlicher sei (und anmutiger) als manches, das wichtig genommen werde. Freilich sei die gegenwärtige Zeit nicht die des Demosthenes: die Religion sei eine andere, die Sitten, die Gesetze, die Reiche. Dennoch bestehe eine Ähnlichkeit. Ein Gebildeter erkenne dies leicht (schliesslich bleibe der menschliche Geist sich stets in allem ähnlich), einem unerfahrenen und schwerfälligen Leser könne man es in Kürze nicht erklären. Und auch wenn man keinen Nutzen ziehen könnte, genösse man bei der Lektüre beredter Autoren und der Betrachtung der alten Zeit eine ehrenvolle Unterhaltung. Im vorliegenden Band nun gehe es um den hitzigen Streit der beiden grossen Redner Demosthenes und Aeschines, die, an sich schon einander feind, sich um den Rednerruhm gestritten hätten, sei dies nun aus einer Verschiedenheit ihrer Naturen: Aeschines als umgänglich, heiter, den Mächtigen zu Willen, Demosthenes streng, bitter, Herrschern Feind. Trotz der - nicht belegten - Beschuldigung des Aeschines als ein Verräter gestehe er beiden Vaterlandsliebe zu. Demosthenes habe seine Ratschläge auf die Würde des Staates und die künftige Sicherheit ausgerichtet, Aeschines das Volk durch seine Sitten für unfähig zum Widerstand gehalten. Zu urteilen, wer richtiger gehandelt habe, stehe ihm nicht zu; jeder möge beider Argumente mit einander vergleichen. Zudem müsse ein Redner seine Worte nicht immer nach der Wahrheit, sondern auf Überzeugung hin ausrichten. Das Volk nämlich lasse sich durch Redner vom Handgreiflichsten abbringen und vom Unglaublichsten überzeugen. Der vierte Grund ihres gegenseitigen Hasses dürfte ihre Rivalität gewesen sein. Wie beide ihre Sache vertreten hätten, ersehe man aus ihren Reden. Hier hätten sie ihre ganze Kunst spielen lassen. Die Reden habe er chronologisch angeordnet, wie Rede und Gegenrede einander gefolgt seien. Die Briefe beider hätten danach am Schluss mit der Rede Dinarchs folgen sollen, doch habe er sie, um den Band nicht zu umfangreich werden zu lassen, in den ersten Band versetzt (S. 155-219, vor die Exordia).
Kürzer ist die Widmung von Band 3, ebenfalls an Fugger: Die zehn Reden dieses Bandes habe er nur um der Handlichkeit willen von den fünf des vorangehenden getrennt. Denn auch hier handle es sich um politische Prozesse. Die Reihenfolge habe er belassen, wie sie sich in den meisten griechischen Codices finde. Denn da diejenige, in der die Reden teils von Demosthenes gehalten, teils von andern aufgeschrieben seien, ihm nicht sicher genug gewesen sei, habe er nicht willkürlich ändern wollen. Es sei auch nicht wichtig. Es ergebe sich doch keine vollständige Geschichte des athenischen Staates und es genüge, wenn die Privatreden von den staatlichen getrennt seien. Und wenn man nach der Würde des Stoffes oder nach dem rhetorischen Schmuck aufreihen wolle, kämen wohl alle auf den gleichen Platz. Worauf Wolf kurz auf Inhalt und Ziele der einzelnen Reden eingeht und auf die ausführlicheren Zusammenfassungen des Libanius verweist.
Nicht länger, doch voll zeitkritischen Ernstes ist die Widmung des vierten Teils, der Privatreden: Die Rechtsprechung der Römer und Athener sei anders als die heutige gewesen: die Parteien hätten voll vorbereitet mit ihren Zeugen, ihren Argumenten erscheinen müssen, dass man noch am selben Tag den Prozess habe entscheiden können. Wie vorteilhaft dies gewesen sei, bezeugten heute unzählige Leute, die weder vor ihren Sykophanten Ruhe hätten noch durch das Gericht von ihren Leiden befreit werden könnten. Wie viele Prozesse liessen die Advokaten reich, die Prozessparteien arm werden, wie viele würden gar bis zu den Enkeln weitergezogen. Einst seien zum Vorteil der Gerechtigkeit gute Könige eingesetzt worden, jetzt gehe durch Kriege und Streitereien alles drunter und drüber. Laut Empedokles bestehe die Natur aus Streit und Freundschaft. Doch jenen finde man überall, zu Wasser und zu Lande, zu Hause wie vor den Altären, diese suchten alle, fänden sie aber nirgends. Dieser letzte Band enthalte dreissig Reden zu privaten Rechtssachen, ausser deren vier nicht von Demosthenes selber gehalten, sondern für Freunde und andere geschrieben, die diese vor Gericht vorzutragen gehabt hätten. Wenn auch ihr schlichter Inhalt und ihr einfacher Stil nicht besonders anzögen, so unterhalte doch die Abwechslung und die Schlauheit des Redners. Zudem könne man mit Nutzen das einfache Verfahren der antiken Gerichte mit der jetzigen Verworrenheit vergleichen, besonders Herrscher, die dieser abzuhelfen suchten. Von den römischen Kaisern seien einst Leichtfertigkeit und Verantwortungslosigkeit der Redner eingeschränkt worden durch den Ernst und die Mässigung der Juristen. Wenn die Nachfolger jener Redner diese nun gar überträfen, die Unterlegenen zu Siegern machten oder die Prozesse in alle Ewigkeit hinauszögen, wo hätte die Unschuld dann noch einen Hafen gegen Verleumdung und Unrecht? Doch er sei Grammatiker, nicht Gesetzgeber, und wolle nur, dass Demosthenes und Aeschines nun auch lateinisch gelesen werden könnten.
Exemplar aus Besitz des Johannes Fridericus Niger Basiliensis von 1613, wohl des Basler Pedells Johann Friedrich Schwarz (1584-1639) von 1613 bis 1618, Pfarrers von Münchenstein, dann Langenbruck, dann Rothenfluh 1618-1639: B c VIII 83/84
Bibliothekskatalog IDS
Signatur: Bc VIII 83 | Bc VIII 84