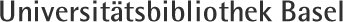GG 263
Hērodotou Logoi Ennea, hoiper epikalountai Mousai.
Herodoti Libri novem, quibus Musarum indita sunt nomina, Kleiō Clio. Euterpē Euterpe... Kalliopē Calliope.
Ad haec Geōrgiou Gemistou, tou kai Plēthōnos, Peri tōn meta tēn en Mantineia machēn biblia b'.
Georgii Gemisti , qui et Pletho dicitur, de ijs quae post pugnam ad Mantineam gesta sunt, Libri II. Una cum Ioachimi Camerarii Praefatione, Annotationibus, Herodoti vita: deque figuris & qua usus est Dialecto: omnia in studiosorum utilitatem diligenter conscripta. Basel: Johannes Herwagen März 1541. Fol.
1502 war in Venedig, wie nicht anders zu erwarten bei Aldus Manutius, der erste griechische Druck des Geschichtenwerks Herodots, des "Vaters der Geschichte" erschienen, nachdem eine lateinische Übersetzung Lorenzo Vallas schon 1474 ebenfalls in Venedig, 1475 in Rom und 1494 nochmals in Venedig gedruckt worden war. Während die Übersetzung Vallas in den folgenden Jahren bis 1541 noch 1510 und 1528 in Paris, 1526 und 1537 in Köln erschien, ist unsere Ausgabe von 1541 erst der zweite griechische Druck des Werkes, somit auch der erste ausserhalb Italiens. Beigegeben ist ein weiterer griechischer Zweitdruck, die Schrift des byzantinischen platonischen Philosophen Georgios Gemistos genannt Plethon (1360-1452) Über die Taten der Griechen nach der Schlacht von Mantinea (362: Niederlage der Arkader/Athener/Spartaner gegen Theben; Zusammenfassung nach Diodor und Plutarch), worin Plethon sich auch mit den gleichzeitigen Versuchen Platons zu einer Verwirklichung seiner politischen Ideen auf Sizilien beschäftigt hat. Ein erstes Mal war die historisch-philosophische Schrift im Anhang an den ersten griechischen Druck der Hellenika, der Griechischen Geschichte Xenophons von 411 bis 362 ebenfalls bei Aldus Manutius erschienen (eine Titelauflage nur des Plethon daraus nochmals 1525). Herausgeber unseres Druckes ist der Tübinger, dann Leipziger Gräzist Joachim Camerarius (1500-1574); 1535 hatte Philipp Melanchthon ihn zu einer Reformation der Universität nach Tübingen berufen, im Jahre des Erscheinens unseres Druckes zum selben Zweck an die Universität Leipzig. Die Ausgabe hat er, ohne Datum und Ortsangabe, dem Fürsten Georg von Anhalt (1507-1553) gewidmet. Allen Menschen sei, beginnt er seine Widmung von über elf Folioseiten, in der er von Erinnerungen an seine frühen Studien und seine Lehrer zu einer Verteidigung des Geschichtswerks seines frühen Lieblingsautors übergeht, mit Euripides, den hier Cicero übersetzt habe, die Erinnerung an vergangene Mühsal süss, lasse zuweilen sogar Ruhm erhoffen. So erinnere er sich seiner ersten Studien, die er an der Leipziger Universität unter Magister Georg Helt aus Vorheim getrieben habe, dem ihn seine Mutter mit zwölf Jahren anvertraut habe (Georg Helt aus Vorheim/Forchheim in Franken, um 1485-1545, nach Studien bei Murmellius in Münster und in Leipzig hier Lehrer des Lateins, wo u.a. Camerarius 1513-1518 und Georg von Anhalt 1519 seine Zöglinge wurden, zuletzt Rektor im anhaltischen Dessau). Fast fünf Jahre sei er bei ihm gewesen, und jener habe väterlich keine Mühe zu seiner Erziehung und Ausbildung gescheut. Obwohl er ihn als Lehrer gefürchtet habe, habe er ihn auch wie einen Vater geliebt. Zu jener Zeit, da die Wahrheit der Studien, der Humanität und der Künste täglich gewachsen sei, seien in Leipzig die Griechischkundigen Richard Croke aus England und dessen Schüler aus Niederdeutschland Johannes Metzler aus Breslau eingetroffen, dieser - später als Jurist bis zu seinem Tod in seiner Heimatstadt in höchsten Ehren - seinem Lehrer ebenbürtig (Metzler, 1494-1538 hatte sich nach einer Italienreise mit seinem Griechischlehrer Croke 1515 nach Leipzig begeben und war dort nach Croke's Rückkehr nach Cambridge Professor der griechischen Sprache geworden; 1532 wurde der Jurist Ratsherr, 1534 Stadt- und Landeshauptmann in Breslau, wo er noch in dieser Stellung am Gymnasium griechische und lateinische Autoren behandelt haben soll; seine Primae grammatices Graecae partis rudimenta waren 1529 in Hagenau erschienen). Wenig später Petrus Mosellanus (der bedeutende Leipziger Philologe und Pädagoge Peter Schade). Sein Lehrer habe erkannt, dass in der wissenschaftlichen Ausbildung ohne Kenntnis der griechischen Sprache nichts ausgerichtet werde, habe selber, obwohl vorgerückten Alters, gelernt und ihn zum Studium dieser Sprache ermuntert, aber auch, kraft seines Amtes, gezwungen. Er habe ihn deren Dolmetschern, vor allem dem ihm freundschaftlich verbundenen Croke, anvertraut, dank seinem Einfluss und einem Lohnversprechen von seiner Seite, und alle drei Jahre nicht aufgehört, ihn anzutreiben. Und als Croke beschlossen habe, bei sich zu Hause privat die Geschichten Herodots zu erklären, habe sein Lehrer ihn hingeschickt, damit er diesen Autor kennenlerne. Und wenn auch Croke in seiner Erklärung kaum bis zum 2. Buch gekommen sei, so habe er doch, gefangengenommen von seiner Anmut, Eleganz und Leichtverständlichkeit, nachdem er einmal seinen abweichenden Dialekt verstanden habe, ständig weiter in ihm gelesen, und verdanke grossenteils ihm seine Griechischkenntnisse. Daher liebe er auch jetzt noch besonders den Codex (vermutlich ein Exemplar der Aldina), den er damals benützt und dann von seinem Lehrer erhalten habe, in dem er immer wieder geblättert und ihn bearbeitet habe, auf allen Seiten voller Anmerkungen von seiner Hand; und stets wenn er ihn sehe, müsse er etwas in ihm lesen. Dann erinnere er sich seiner kindlichen Studien und freue sich, dass sie nicht umsonst gewesen seien. Und er liebe diesen Autor am meisten von allen. Als er nun erfahren habe, dass Exemplare seiner Geschichten von den Studenten gesucht würden und kaum noch zu finden seien, sei er an den tüchtigen Drucker Johannes Herwagen herangetreten, ihn denen zuliebe zu publizieren, auch wenn dies mehr ein Zeugnis seiner Liebe als seines kritischen Urteils sein könnte. So wolle er hier für seine Wertschätzung Rechenschaft ablegen und zeigen, dass seine Gegner nicht nur bösartig, sondern sogar unklug handelten. Bei jedem Autor pflege zuerst sein Vorwurf und dessen Darstellung betrachtet zu werden. Lob verdiene da, wenn ein Vorwurf gewählt werde, dessen Kenntnis andern nützen und dessen Qualität andern gefallen könne, sodann wenn die Darstellung in Worten und Sätzen dem angemessen sei. In beidem aber müsse man in Herodot den grossartigsten Autor sehen. Dazu komme das Gewicht des Alters. Mit der Darstellung der Vorzeit, verschiedener Völker, vor allem aber der Perser und Griechen, habe er die bedeutendsten Stoffe gewählt, nicht nebensächliche wie andere alte und die späteren sophistischen Autoren, die mit nichtigen Themen nur die Sinne hätten erfreuen wollen, wie z. B. jener Autor mit den Äthiopischen Geschichten (die Erstausgabe [GG 252] von Heliodors Aithiopika war gerade 1534 bei Herwagen erschienen) und der Syrischen Göttin (Lukian gemeint?). Auch davon finde sich etwas bei ihm, doch sei das nicht die Hauptsache der Geschichtsschreibung, sondern nur Ausschmückung und Zugabe (expolitio & exaggeratio). Ihr Stoff seien Gründungen, Umstürze, Wandlungen der grossen Reiche, Eroberungen reicher Städte, Abfolgen der mächtigen Könige, das Geschick und die Herrschaft berühmter Völker. Seine Sprache komme angenehmst daher, reich an Schmuck. Einzig sein Satzbau (compositio) sei frei, wie es Cicero gefalle, d.h. unrhythmisch, mit einer natürlich-rhythmischen Modulation, die durchaus ihren Reiz habe. Die Erzählweise sei beredt, die Angaben deutlich und klar, die Erklärungen verständlich, die Stoffsammlungen reich und glaubhaft. Klar die unterschiedliche Darstellung von Gesichertem, Zweifelhaftem und Fabulosem. Eine erstaunliche Einfachheit und Lauterkeit. Dies alles mache den Ruhm und die Würde der Geschichtsschreibung aus. Gegen seine Tadler werde er alles dies, nur ausführlicher, nochmals ins Feld führen. Gegen den Vorwurf der Lügen brauche es nicht viel, und den habe auch schon Aldus Manutius widerlegt (in der Widmung seiner Ausgabe). So hätten vor allem Herodots Schriften die Satiriker (Iuvenal, Sat. 10 wird marginal angeführt) veranlasst, die griechische Geschichtsschreibung der Verlogenheit zu zeihen. Manche würden ihn wegen eingestreuter kleiner märchenhafter Erzählungen, die der Geschichtsschreibung nicht würdig seien, als Lügner hinstellen. Doch was einem wegen seiner Grösse unglaubhaft scheine, dürfe man nicht verurteilen; es sei denn, man erklärte nur für wahr, was einem selber entspreche. Wie vieles berichteten die, die jenes Alte für erfunden zu erklären wagten, selber, was kein Leser ihnen abnehme. Auch unsere Nachfahren würden einmal vieles für übertrieben halten, was jetzt vollkommen wahr sei. Freilich sei manches eher nichtig, wie in den Erzählungen der Reisenden vom Ende der Welt; aber deswegen dürfe man nicht die ganze Erzählgattung für wertlos erklären. Seine Schilderung Babylons könne man an den eigenen Städten und dem Bericht des Aristoteles messen, die Fruchtbarkeit Assyriens an den eigenen Feldern. Die Grösse Babylons und des Heeres des Xerxes zeige die Grösse der Gefahr für Griechenland und dass auch die Mächtigsten nicht unbesiegbar seien. Mit anderem, wie den Greifen, den indischen Ameisen, dem Phönix (die sich auch in Sebastian Münsters Cosmographien noch bzw. wieder finden) werde allerdings nur Unterhaltung bezweckt. Für diese Märchen sei er aber nicht der Lüge zu zeihen, vielmehr für deren geschickte Einfügung zu bewundern. Er setze auch immer ein distanzierendes "Wie es heisst" hinzu. Der Wahrhaftigkeit des Gesamtwerks schadeten sie nicht. Wie die gewiss nicht so gehaltenen Reden Thukydides Ruhm der Erhabenheit eintrügen, so diese Märchen Herodot solchen der Anmut. Es seien Exkurse, die nicht zur Sache gehörten: in keiner Gattung sei Bildung und Intelligenz zu eng zu begrenzen; gerade Zutaten seien Früchte des Geistes und des Fleisses. Sie würden die Geschichtsschreibung keineswegs verderben, sondern zieren. Nicht schmucklos, nackt und knapp, sondern prächtig gekleidet müsse die Geschichtsschreibung sein. Ihre Glaubwürdigkeit liege in den Zeitangaben, den Namen, in der bestimmten Wiedergabe der Geschehnisse, in der aufmerksamen Verfolgung der Vorhaben. Dies finde sich alles bei Herodot. Geschichte habe nicht nur die Erkenntnislust zu befriedigen, sondern auch zu belehren, Genuss und Nutzen zu bringen. Und da seien manche scheinbar unglaubhafte Schilderungen geradezu symbolträchtig für gewisse Abläufe. Aber schon Plutarch habe Herodot in einer eigenen Schrift bissig gar der Bösartigkeit geziehen. Doch mit seinen negativen Urteilen müsse Herodot nicht unrecht haben, man müsse auf die Art des Urteils achten. Und Plutarch habe mit seinem Vorwurf der Bösartigkeit selber eine solche verraten. Denn als er gewissermassen Beispiele des Unterbewusstseins der Bösartigkeit (intimos sensus & reconditam voluntatem pravitatis malignorum) gesammelt gehabt habe, habe er, wie Knaben von ihren Lehrern geheissen würden, gewisse überlieferte Stoffe kapitelweise abzuhandeln, nach seinem Vorsatz die Anklage gegen unsern Autor vorgebracht. Er verberge aber auch nicht den Grund seines Hasses: eine ungerechte Schmähung seiner Böotier. Auch die Anmut seiner Sprache, mit der er den Leser gewinne, werfe er ihm vor wie vieles andere (was Camerarius im folgenden aufzählt), das er nicht bei Herodot, sondern in seinem eigenen Kopf gefunden habe. Warum bemängle er seinen Wortschatz, der doch, nach seiner Meinung, genau der Sprache seiner Zeit entspreche und dessen Unterschied gegenüber später sogar jetzt verständlich sei? Und wozu werfe er ihm vor, dass er die Dinge bei ihrem Namen genannt habe? Er habe die Geschichte sich aus eigener Überzeugung vorgenommen und dargestellt, und es sei ungerecht, wenn einer seinen Geist am Werk eines andern entfalten wolle, zumal um diesen blosszustellen. Er habe es so berichtet, wie er es erkannt oder gehört habe. Aber trotz dieser Überzeugung weise er auf Plutarchs Bösartigkeit hin, denn Verleumdung bleibe an Göttlichem und Menschlichem, an Heiligem und Profanem hangen. Richtiges solle man nicht schmähen, Falsches als solches überführen, und nicht mit Klügeleien alles der Bösartigkeit verdächtigen. So habe Herodot keineswegs nur die Athener gelobt (und wegen dieses Lobs argwöhne Plutarch sogar eine Bestechung), sondern ganz ebenso auch die Spartaner, und entgegen Plutarchs Kritik habe der Ausdruck Sophist zu Herodots Zeit ganz sachlich die Handwerker eines Wissens oder einer Kunst bezeichnet, wie Kitharist oder Grammatist, und sei erst später durch menschliche Fehler, wie vieles andere, zu seinem schlechten Ruf gekommen. Und auch der Vorwurf der Gottlosigkeit, weil er Solon Göttliches den Menschen verständlich äussern lasse, sei läppisch: Xenophon, wahrlich der Feind jeder Gottlosigkeit, äussere Ähnliches. Und ebenso der Vorwurf, dass Herodot von den Ephesiern, Kolophoniern, Chiern Dinge berichte, die der ältere Charon von Lampsakos (nur indirekt fragmentarisch erhalten) nicht erzählt habe, als ob Herodot nur Dinge hätte berichten dürfen, die schon vor ihm veröffentlicht worden seien, zumal er selber erklärt habe, beschlossen zu haben, von andern nicht Erfasstes zu erwähnen. Unter den weiteren Verleumdungen geht Camerarius noch besonders auf Plutarchs Verteidigung seiner Thebaner ein, von deren Falschheit aber allgemein - auf ihren Verrat im Perserkrieg zurückgeführt - berichtet werde. Der Dummheit zeihe Plutarch Herodot nicht - aber was hätte es Dümmeres und Frecheres geben können, als Jüngstvergangenes, inschriftlich Überliefertes öffentlich falsch vorzutragen? Hinausgeworfen aus dem Theater hätte man ihn. Worauf Camerarius die Schilderung der Thermopylenschlacht - ohne Namen nur durch das Geschehen und die Angabe "in illis angustiis" für die Leser des 16. Jahrhunderts genügend gekennzeichnet - rechtfertigt. Auch am Ausdruck "Flucht" nehme Plutarch zu Unrecht Anstoss; sogar der König der Könige habe vor Troia zur Flucht aufgerufen. Doch obwohl gelehrte und gescheite Männer leicht herausfänden, wie sie durch eine Aussage etwas verhasst und verdächtig machen könnten, die Macht der Wahrheit sei doch so gross, dass sie meist trotz Unterdrückung irgendwie gegen die Schliche an den Tag komme. Daher wolle er nicht weiter behandeln, was Plutarch gegen Herodot zusammengesucht habe, sondern die Sache selber. Plutarch habe hier doch wohl nicht seine Meinung äussern, sondern andern willfahren oder seine Kunst in übler Rede vorzeigen wollen. Denn er sei doch wohl nicht nur gelehrt, sondern auch anständig gewesen und habe nur in dieser Schrift zu wenig auf seinen Ruf geachtet. Man werfe ihm als Herausgeber nun aber auch das vor, was Thukydides Herodot vorgeworfen haben solle: märchenhafte Erzählungen und erfundene Geschichten zur augenblicklichen Unterhaltung der Zuhörer, doch ohne jeden bleibenden Nutzen herauszubringen. Aber das gelte nicht mehr für Herodot als für jeden Historiker vergangener Zeiten. Und er glaube nicht, dass Herodot gemeint habe, jene alten zur Unterhaltung verfassten Geschichten wie die des Pherekydes der Wahrheit der Geschichte, leichten Stil der Würde der Erzählung vorziehen zu müssen. Doch darüber möge jeder nach seinem Geschmack urteilen. Kurz: Herodot müsse man nicht nur wegen der Eleganz und der sogar von Cicero gepriesenen Anmut seines Stils immer wieder lesen, sondern wegen seiner Sachkenntnis und seiner nützlichen Lehren und allen andern seiner Gattung vorziehen. Von den Lateinern seien die Elogien Ciceros und Quintilians bekannt, die Meinung der Griechen kennzeichne genügend die Benennung der Bücher nach den Musen, mit denen das Altertum jede Weisheit, Lehre und Geistesgrösse bezeichnet habe. Daher reue ihn nicht die für ihn aufgewandte Zeit noch die Aufforderung an alle, sich mit ihm zu beschäftigen. Und ihm, Georg von Anhalt, widme er ihn wegen seiner Wahrheitsliebe, wegen seiner unglaublichen eigenen Bemühungen um die Geisteswissenschaften (artes humanitatis) und seiner Förderung ihrer Anhänger, vor allem aber wegen seiner langjährigen Förderung des gelehrten Georg Helt an seinem Hofe. Die Widmung gelte auch diesem als Zeichen seiner Verehrung. Für diese Förderung verdiene er höchstes Lob, und in einer Widmung werde das, auch wenn für ihn bestimmt, allgemein verbreitet. Dazu gehörten auch geradezu göttliche Bemühungen um die richtige Pflege der christlichen Religion, an der unser ganzes Heil hange (Georg war wie Camerarius Anhänger der lutherischen Reformation, dennoch aber von Karl V. hoch geschätzt). Und man sehe, wie sie missachtet werde: Ehrsüchtige und Habgierige, Fürsten, die sich nicht an den ihnen von Gott vorgeschriebenen und bestimmten Weg hielten. Er sei seinem leidenden Jahrhundert von Gott gesandt worden. Und er möge auch ihm, seinem Bewunderer, einen Platz gönnen, als einem Schüler Georg Helts, der die Arbeit des Lehrers als nicht ganz wirkungslos erweise (im Erscheinungsjahr dieser Herodotausgabe und damit auch dieser Widmungsvorrede ist Camerarius durch Betreiben Melanchthons aus Tübingen an die Universität Leipzig berufen worden). Es folgen eine Abhandlung über Herkunft, Leben und Einfügung Herodots in die Geschichte der griechischen Literatur, in der sich Camerarius mit den verschiedenen antiken Äusserungen auseinandersetzt, und eine zweite sehr ausführliche über den jonischen Dialekt, gegliedert in einen allgemeinen Teil über die lautlichen Eigenheiten und einen zweiten über Redensarten und einzelne Wörter der "frühen jonischen Sprache". W 95.
Ex libris Bibliothecae Academiae Basiliensis, zusammengebunden mit dem Solin-Druck Michael Isingrins und Heinrich Petris von 1538: B c I 55 Nr. 1. Das Exemplar B c I 56 des seitengleichen Nachdrucks Herwagens mit Bernhard Brand vom März 1557 hat sich 1564 ein SLVP einbinden lassen, danach im Besitz Remigius Faeschs; das Exemplar B a Ia 83 (Einband u.a. Porträtplatte Nicolaus Reusner Leorin.) hat am 20.2.1582 ein Marcus Beumlerus für 9 Batzen in Tübingen erworben, später Besitz des Basler Mathematikers Daniel Huber.